© Lisa Widerek 2025 · Ich will schlafen. Mein Körper auch. Aber mein Gehirn hat noch drei Meetings und ein Feuerwerk geplant. Warum so viele neurodivergente Menschen nachts nicht schlafen können – und was wirklich hilft. Ein ehrlicher Erfahrungsbericht über Melatonin, Reizoffenheit, Gedankenkarussell und die Macht von Selbstmitgefühl.
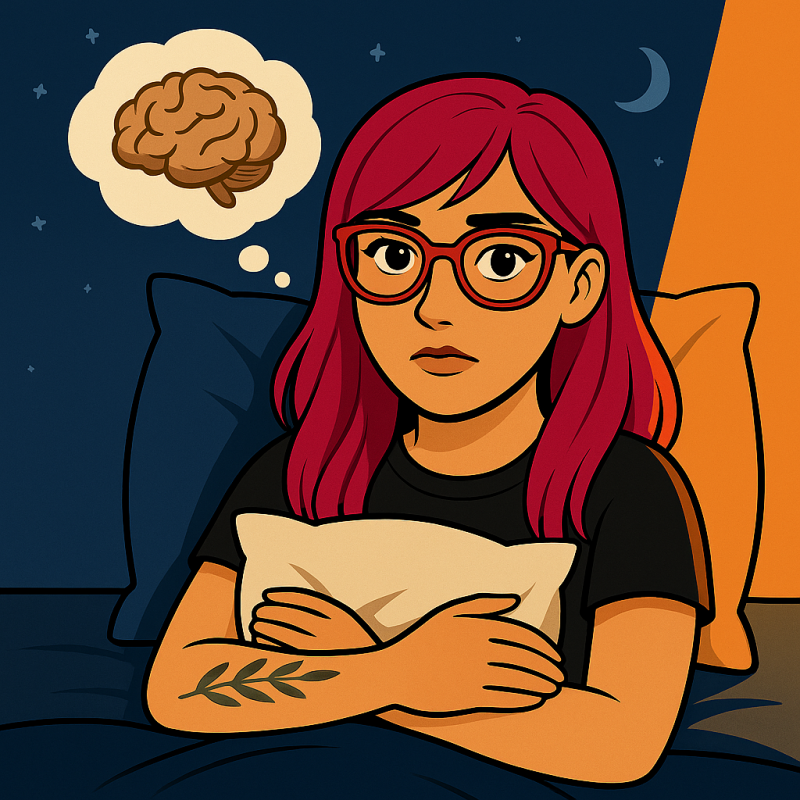
Die Nacht, die kein Ende nimmt
3:17 Uhr. Das Display meines Handys flackert in meine müden Augen. Eigentlich wollte ich es nicht mehr benutzen, wenn ich nicht schlafen kann – aber hier liege ich. Wach. Innerlich aufgewühlt. Mein Körper fühlt sich müde an, schwer, erschöpft. Und gleichzeitig rast mein Kopf. Gedanken, die sich überlagern. Szenarien, die ich längst tausendmal durchdacht habe. Emotionen, die mich überrollen, obwohl niemand außer mir sie gerade fühlen kann.
Ich wälze mich von einer Seite auf die andere. Überlege, ob ich aufstehen soll, etwas lesen, etwas essen. Aber alles fühlt sich falsch an. Ich will doch nur schlafen. Warum geht das nicht?
Dieses Erleben ist für viele neurodivergente Menschen kein Einzelfall – es ist Alltag. Und es ist mehr als nur „schlecht abschalten können“. Es ist ein komplexes Zusammenspiel aus Reizverarbeitung, innerem Druck, biochemischer Taktung und der Frage, warum unsere Nächte sich manchmal wie ein Marathon ohne Ziel anfühlen.
Warum viele Autist:innen und ADHS-Betroffene nicht schlafen können
Neurodivergenz bedeutet oft, dass das Nervensystem anders arbeitet – wacher, empfindlicher, unruhiger. Und genau das spiegelt sich auch im Schlafverhalten:
- Erhöhte Reizoffenheit: Geräusche, Lichter, Bewegungen – was andere ausblenden, bleibt bei uns „an“. Das Einschlafen wird zur Reizverhandlung.
- Gedankenkreisen: Besonders bei ADHS oder PDA-Profilen bleibt der Kopf auf Sendung. Selbst nach einem anstrengenden Tag startet das Gehirn eine zweite Schicht.
- Emotionale Nachverarbeitung: Autistische Menschen durchleben Situationen oft zeitverzögert emotional – nachts kommen dann Gefühle hoch, die tagsüber unterdrückt wurden.
- Verzögerter Melatonin-Spiegel: Studien zeigen, dass bei ADHS und Autismus die körpereigene Melatonin-Ausschüttung verschoben oder reduziert ist (Tordjman et al., 2013). Das biologische „Schlafsignal“ fehlt oder kommt zu spät.
Die Folge? Einschlafstörungen, Durchschlafprobleme, ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus – und das Gefühl, der eigene Körper funktioniert gegen einen selbst.
Was ist eigentlich Melatonin – und warum ist es so wichtig?
Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, das vor allem in der Zirbeldrüse produziert wird. Es wird oft als „Schlafhormon“ bezeichnet, obwohl es eher ein Taktgeber ist: Es hilft dem Körper zu erkennen, wann es Zeit ist, sich zu erholen.
Die Ausschüttung beginnt normalerweise am Abend, wenn es dunkel wird, und erreicht ihren Höhepunkt in der Nacht. Bei neurodivergenten Menschen ist dieser Rhythmus oft verschoben oder gehemmt – was bedeutet: Der Körper weiß gar nicht, dass er jetzt müde werden soll.
Das kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden:
- Geringere Melatoninproduktion
- Späterer Ausschüttungsbeginn (Delayed Sleep Phase Syndrome)
- Reaktion auf Reizüberflutung: Das Nervensystem bleibt im „Wachmodus“
Körperlich müde, aber neurologisch hellwach. Das ist kein Widerspruch. Es ist Realität für viele neurodivergente Menschen.
Warum Melatonin noch immer zu selten verschrieben wird
Melatonin ist rezeptpflichtig – und genau das macht es für viele Familien zu einem zähen, frustrierenden Thema. Obwohl die Wirkung gut erforscht ist und insbesondere bei ADHS und Autismus mehrfach nachgewiesen wurde, wird es in vielen Fällen nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Stattdessen hört man immer wieder Sätze wie:
„Das Kind braucht einfach mehr Bewegung.“
„Frische Luft hilft da besser.“
„Das verwächst sich noch.“
Für Eltern, die nachts stundenlang neben einem wachgeplagten Kind sitzen, klingen solche Aussagen wie Hohn. Sie wachen nicht nur physisch mit, sondern tragen auch die emotionale Erschöpfung mit: die Wutanfälle um Mitternacht, das bittere Weinen um drei, den Zusammenbruch am Frühstückstisch. Wer nie erlebt hat, wie Schlafentzug eine Familie zersägen kann, unterschätzt oft die Dringlichkeit.
Melatonin als Notlösung – statt als reguläre Hilfe
Oft wird Melatonin erst dann verschrieben, wenn alles andere „versagt“ hat. Es gilt als „letzter Ausweg“ – anstatt als legitimer, medizinisch sinnvoller Baustein in der Behandlung neurodivergenter Schlafstörungen. Viele Ärzt:innen scheuen sich, es proaktiv anzubieten. Gründe dafür sind:
- Veraltete Vorstellungen von kindlicher Entwicklung: Die Annahme, dass Kinder „einfach schlafen lernen“ – vor allem durch Konsequenz und Routinen.
- Sorge vor Abhängigkeit: Obwohl Melatonin nicht süchtig macht und kein klassisches Schlafmittel ist, bestehen Vorurteile gegen eine längerfristige Gabe.
- Fehlendes Wissen: Viele Ärzt:innen sind nicht speziell auf Neurodivergenz geschult – Schlafprobleme werden dadurch als Verhaltensproblem fehlgedeutet, nicht als neurologisches Phänomen.
- Angst vor juristischer Verantwortung: Gerade bei Kindern zögern Fachpersonen oft, wenn es um rezeptpflichtige Substanzen geht – selbst wenn die Studienlage eindeutig ist.
Was das für Betroffene bedeutet?
Warten. Kämpfen. Erklären. Wieder von vorne beginnen. Und währenddessen schlafen sie nicht – oder ihre Kinder nicht. Und wer nicht schläft, wird nicht nur müde. Sondern gereizt, depressiv, überfordert. Auch das gehört zur Wahrheit: Der Umgang mit chronischem Schlafmangel ist ein Risikofaktor für emotionale Krisen. Und in einem ohnehin fragilen Alltag mit ADHS oder Autismus kann Schlafmangel das letzte Puzzlestück sein, das alles kippen lässt.
Ich habe bei meinen Kindern selbst erlebt, wie sich das Leben verändert, wenn der Schlaf wieder kommt. Und ich habe genauso erlebt, wie oft man kämpfen muss, um an diesen Punkt zu kommen – gegen Widerstände, gegen Unwissen, gegen die Angst anderer.
Was Betroffene oft versuchen
Wenn der Schlaf ausbleibt, beginnt eine Suche, die oft Jahre dauert. Eine Suche nach Lösungen, nach Linderung, nach einem ganz normalen Alltag.
Wir kaufen Einschlafhilfen.
Wir ändern Abendroutinen.
Wir lesen Ratgeber, installieren Schlaf-Apps, streichen Zucker, erhöhen Bewegung.
Wir stellen Lavendel auf den Nachttisch, verdunkeln das Zimmer, stellen die Temperatur perfekt ein.
Wir massieren Füße, erzählen Fantasiereisen, spielen Meeresrauschen über Boxen.
Und oft… hilft es nicht.
Schlafhygiene ist wichtig – aber nicht alles
In Gesprächen mit Fachpersonen kommt oft als erstes das Thema „Schlafhygiene“. Und ja, geregelte Abläufe, ein ruhiger Abend, weniger Bildschirmzeit – das kann unterstützend wirken. Aber wenn die Ursache eine biologische Fehlregulation der Melatoninproduktion ist, dann reicht das schlicht nicht aus. Es ist, als würde man bei Migräne vorschlagen, erst mal einen Spaziergang zu machen – gut gemeint, aber oft am Thema vorbei.
Gerade bei neurodivergenten Menschen liegt das Problem tiefer:
- Der Tag-Nacht-Rhythmus ist oft verschoben, weil die innere Uhr anders tickt.
- Melatonin wird zu spät oder zu wenig ausgeschüttet – völlig unabhängig von Lichtquellen oder Routinen.
- Reize des Tages werden nicht verarbeitet, sondern mit in die Nacht genommen.
- Das Gehirn ist im Hypermodus, wenn andere schon längst herunterfahren.
In solchen Fällen wirkt eine gute Schlafhygiene wie ein Pflaster auf einen Knochenbruch – sie deckt zu, aber heilt nicht.
Der Unterschied zwischen „nicht schlafen wollen“ und „nicht schlafen können“
Was viele nicht verstehen: Es ist keine Frage von Willenskraft. Neurodivergente Kinder (und Erwachsene) wollen schlafen. Sie sind müde. Sie wissen, dass sie funktionieren müssen. Aber ihr Körper kooperiert nicht. Ihre Gedanken bleiben laut. Ihr System bleibt wach.
Dieses Gefühl, gegen den eigenen Körper zu kämpfen, hinterlässt Spuren. Wer jeden Abend mit sich selbst im Ring steht, verliert irgendwann das Vertrauen – in den eigenen Rhythmus, in das eigene Nervensystem, in das eigene Gefühl von Sicherheit. Und genau das ist die stille Tragik dieser Nächte: Sie untergraben nicht nur die Erholung – sondern auch die Selbstregulation.
Eigene Erfahrungen
Ich habe schon so viele Nächte durchlebt, in denen ich mich regelrecht selbst angefleht habe, doch einfach zu schlafen. Ich lag im Dunkeln, die Augen geschlossen, den Körper völlig erschöpft – aber mein Gehirn hatte noch drei Meetings, zwei Angstspiralen und eine komplette Ideenliste geplant. Und das um 2:47 Uhr. Oder 3:21 Uhr. Oder 4:03 Uhr.
Was für andere selbstverständlich scheint – müde ins Bett, Licht aus, einschlafen – ist für mich ein täglicher Drahtseilakt. Und wenn meine Kinder bei mir sind, ist es manchmal noch schlimmer. Nicht, weil sie mich wachhalten – sondern weil ich dann funktionieren muss. Und je mehr ich weiß, dass ich „morgen fit sein muss“, desto schwerer fällt das Abschalten.
Melatonin hat mir und meinen Kindern geholfen – aber nicht sofort.
Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich zum ersten Mal Melatonin gegeben habe. Ich hatte so sehr gehofft, dass endlich Ruhe einkehrt. Dass das quälende Hin- und Herwälzen aufhört. Dass das Herzklopfen runterfährt. Dass die Gedanken einfach pausieren.
Und ja – es hat geholfen. Nicht immer sofort. Nicht magisch. Aber es war der erste Schritt. Und der Unterschied war spürbar: Die Einschlafzeit wurde kürzer. Der Kampf kleiner. Die Nächte erträglicher.
Aber das Entscheidende war: Ich hatte wieder ein Werkzeug in der Hand. Ich war nicht mehr völlig ausgeliefert. Nicht mehr nur Zuschauerin in meinem eigenen, überdrehten Nervensystem – sondern Teil der Lösung.
Der Unterschied zwischen Ruhe und Kontrolle
Was Melatonin mir geschenkt hat, war nicht nur Schlaf – sondern das Gefühl, wieder Kontrolle zu haben. Über mein Erleben. Über meine Abende. Über meinen Rhythmus. Witzigerweise allerdings auch mal ein blaues Auge. Eine gut gemeinte, mit einem Schmunzeln zu betrachtende Empfehlung von mir: Wer gewohnt ist, sich müde zu scrollen, sollte das Handy nach der Gabe von Melatonin nicht unbedingt über sein Gesicht halten dabei.
Und genau das ist es, was viele nicht verstehen: Es geht nicht nur darum, die Nacht zu überstehen. Es geht darum, das eigene System wieder in die Hand zu nehmen. Wieder vertrauen zu können: auf das eigene Gefühl, auf den Körper, auf den nächsten Morgen.
Was hilft wirklich?
Melatonin ist keine Notlösung – sondern manchmal genau das, was fehlt.
Viele von uns haben es mit Einschlaftees, Lavendelkissen, „Schlafhygiene“ oder festen Routinen versucht. Und ja – das alles kann unterstützen. Aber wenn die innere Ampel nicht auf Nacht schaltet, wenn der Körper kein Signal bekommt, dass Ruhezeit ist, dann bringt auch die liebevollste Abendroutine oft nichts.
„Nicht die Müdigkeit fehlt – sondern das Startsignal für den Schlaf.“
Gerade bei ADHS und Autismus ist oft nicht der Schlafwunsch das Problem – sondern die biologische Taktung. Studien zeigen, dass bei Betroffenen die Melatonin-Ausschüttung nicht nur verzögert, sondern manchmal regelrecht gestört ist (Rossignol & Frye, 2011). Und das bedeutet: Der Körper ist wach, obwohl der Mensch längst müde ist.
Melatonin kann hier helfen – nicht als Einschlafdroge, sondern als innerer Rhythmusgeber.
Es ist kein Hammer wie ein Benzodiazepin. Es knockt nicht aus. Es sagt einfach nur: Jetzt ist Nacht. Und diese sanfte Botschaft kann ausreichen, damit das System endlich in die Ruhe findet.
„Melatonin ist kein Schlafmittel – sondern ein Taktgeber.“
Besonders bei Kindern mit Autismus oder ADHS hat sich gezeigt, dass niedrig dosiertes, zeitlich genau abgestimmtes Melatonin zu besseren Einschlafzeiten, längerer Gesamtschlafdauer und spürbarer Entlastung im Familienalltag führen kann (Gringras et al., 2012).
Warum wird es dann so selten empfohlen?
Weil noch immer viele Ärzt*innen denken, Schlaflosigkeit sei ein Erziehungsproblem. Oder weil sie Angst vor „Gewöhnung“ haben – obwohl es keinerlei Hinweise auf Sucht oder Abhängigkeit bei richtig eingesetztem Melatonin gibt. Viel häufiger ist das Gegenteil der Fall: Menschen gewöhnen sich nicht daran zu schlafen, weil sie nie gelernt haben, was ihnen fehlt.
„Schlafstörungen bei Autismus und ADHS sind keine Verhaltensprobleme – sondern neurobiologisch erklärbar.“
Es ist höchste Zeit, dass wir aufhören, diese Realität zu pathologisieren oder zu bagatellisieren. Schlaf ist keine Luxusauszeit. Er ist eine neurobiologische Grundvoraussetzung für Gesundheit, Regulation, Lernen und Leben.
Und deshalb sollten wir ihn auch so behandeln: mit Respekt, Wissen und echter Unterstützung.
Wenn „frische Luft“ nicht reicht: Typische Missverständnisse im System
Ich habe oft gehört:
„Ihr Kind braucht einfach mehr Bewegung.“
„Machen Sie doch abends das Handy aus.“
„Das ist nur eine Phase.“
„Ein warmes Bad hilft immer.“
Solche Ratschläge klingen harmlos – aber sie verkennen die Realität. Sie verschieben das Problem weg von der Biologie hin zur „fehlenden Disziplin“. Dabei zeigen Studien seit Jahren, dass Schlafprobleme bei ADHS und Autismus nicht willentlich steuerbar sind – sondern oft aus neurologischen Ursachen resultieren (Cortese et al., 2009).
Und doch erleben viele Eltern, dass sie sich rechtfertigen müssen, wenn sie Melatonin geben. Oder dass sie schräg angeschaut werden, wenn sie sagen: Mein Kind schläft ohne das gar nicht ein. Als hätten sie versagt. Oder schlimmer: Als würden sie ihrem Kind schaden.
Dabei ist die eigentliche Frage: Warum fällt es unserer Gesellschaft so schwer, neurodivergentes Erleben ernst zu nehmen?
Stattdessen wird:
- Schlaflosigkeit als Erziehungsproblem behandelt,
- Melatonin als „Beruhigungsmittel“ diffamiert,
- und das Leiden der Betroffenen systematisch kleingeredet.
Was Betroffene und Angehörige stattdessen brauchen, ist keine Ermahnung – sondern Aufklärung.
Wirkliche, informierte Unterstützung. Ein Verständnis dafür, dass nicht jede Einschlafstörung mit Kräutertee gelöst werden kann. Und dass die Entscheidung für Melatonin kein Scheitern ist – sondern ein Schritt in Richtung Selbstfürsorge.
Was sich verändert hat – eine persönliche Erfahrung
Ich erinnere mich an Abende, an denen ich völlig entkräftet im Flur saß, während mein Kind im Zimmer hin und her lief, sichtlich erschöpft – aber unfähig, herunterzufahren. Ich hatte alles versucht: Vorlesen, Licht dimmen, Körperkontakt, beruhigende Musik. Nichts half. Und irgendwann blieb nur noch dieses beklemmende Gefühl: Ich komme nicht mehr an ihn ran.
Es war nicht Trotz. Kein Aufmerksamkeitsproblem. Es war, als ob sein Körper nicht wusste, dass die Nacht begonnen hatte.
Der Moment, in dem wir zum ersten Mal Melatonin gegeben haben, war ehrlich gesagt ambivalent. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Ich fühlte mich schuldig – als hätte ich versagt. Aber was dann geschah, war keine Betäubung. Kein Knockout. Sondern eine sanfte Erleichterung. Er wurde ruhiger. Friedlicher. Und irgendwann – einfach so – schlief er ein.
Seitdem hat sich so viel verändert.
Nicht jede Nacht ist perfekt. Aber wir haben einen Anker. Einen Rhythmus. Eine Rückversicherung, dass wir nicht hilflos ausgeliefert sind. Ich habe gelernt, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen – auch dann, wenn andere sie nicht verstehen. Und dass Schlaf nicht erarbeitet werden muss. Sondern dass es Menschen gibt, deren Körper einfach andere Unterstützung braucht.
Heute weiß ich:
Melatonin war kein Eingeständnis von Schwäche. Es war der Beginn von mehr Ruhe. Für mein Kind – und für mich.
Wenn der Schlaf fehlt – und plötzlich alles zu viel ist
Ich habe lange gedacht, dass mein Gewichtsproblem einfach mit Disziplin zu tun hat. Doch irgendwann wurde mir klar: Wenn ich übermüdet bin, esse ich anders. Nicht achtsam. Nicht nach Hunger. Sondern nach Reiz. Nach Zucker. Nach schnellem Trost. Mein Körper schreit dann nicht nach Nahrung – er schreit nach Regulierung.
Und das ist nur ein Teil der Wahrheit.
Denn wenn der Schlaf fehlt, bin ich nicht mehr ich. Ich werde empfindlich, schnell überfordert, impulsiv. Ich heule plötzlich, wenn das Handtuch falsch liegt. Ich schreie, obwohl ich das gar nicht will. Ich reagiere auf meine Kinder nicht mehr mit dem Herzen – sondern mit dem Nervensystem auf Anschlag.
Es ist, als würde mein inneres Stressbarometer schon bei Kleinigkeiten überlaufen.
Ich will nicht hart sein. Nicht brüllen. Nicht Dinge sagen, die ich später bereue. Aber ohne Schlaf... fällt es mir oft schwer, überhaupt meine Mitte zu spüren.
Und genau deshalb ist es so wichtig, Schlaf nicht als Luxus zu betrachten – sondern als elementare Grundversorgung. Nicht nur für Kinder. Auch für Eltern. Für mich.
Denn wenn ich ausgeschlafen bin, bin ich nicht nur sanfter mit mir.
Ich bin auch die Mutter, die ich sein will.
Der Teufelskreis: Schlafmangel, Reizoffenheit, Überforderung
Wenn ich schlecht schlafe, merke ich das nicht nur an der Müdigkeit. Ich merke es an meiner Haut, die zu viel spürt. An Geräuschen, die zu laut sind. An Menschen, die zu nah kommen. Ich merke es an meinen Gedanken, die nicht mehr sortiert sind, und an meinen Reaktionen, die schneller ausbrechen, als ich sie einfangen kann. Ein falsch gesetzter Ton, ein schiefer Blick, eine minimale Störung – und ich bin kurz davor zu explodieren oder zu weinen.
Und dann kommt die Scham.
Ich frage mich: Was stimmt nicht mit mir? Dabei stimmt alles – nur mein Nervensystem ist erschöpft. Schlafmangel macht mich reizoffener, und diese Reizoffenheit wiederum macht das Einschlafen schwerer. Ich bin im Daueralarm, und mein Körper findet den Ausgang nicht. Es ist ein Teufelskreis, den viele neurodivergente Erwachsene kennen. Und je länger er andauert, desto eher wird aus einem funktionierenden Alltag ein Dauerkrisenmodus.
Funktionieren im Beruf – wenn Müdigkeit keine Ausrede ist
Was viele nicht verstehen: Nur weil ich gearbeitet habe, funktionierte, Termine halten konnte – hieß das nicht, dass es mir gut ging. Im Gegenteil. Gerade Erwachsene mit ADHS oder Autismus perfektionieren oft das Maskieren ihrer Erschöpfung. Sie wissen, dass Müdigkeit nicht als „richtiger“ Grund gilt. Dass man lieber eine Erkältung vorgibt, als zu sagen: Ich kann nicht, weil ich seit vier Tagen kaum geschlafen habe.
Im Beruf zählt, was sichtbar ist – nicht, was fühlbar ist. Und Schlafprobleme sind unsichtbar.
Das macht es doppelt schwer: Ich bin nicht nur erschöpft – ich bin es heimlich. Und das führt zu einem toxischen Gefühl: Ich bin zu schwach für diese Welt. Aber das stimmt nicht. Ich bin nicht schwach – ich bin chronisch unterversorgt mit Schlaf, mit Verständnis, mit Pausen, mit Rücksicht. Und ich darf aufhören, mich dafür zu schämen.
Neurobiologie und Selbstvergebung – es ist nicht deine Schuld
Viele Menschen mit ADHS, Autismus oder sensorischen Besonderheiten haben eine ganz reale biologische Ursache für ihre Schlafprobleme: Die Melatonin-Ausschüttung ist verzögert oder zu niedrig. Das ist keine Einbildung, keine Ausrede, kein „schlechter Lebensstil“ – es ist neurobiologische Realität. Studien zeigen, dass neurodivergente Menschen eine veränderte Schlafarchitektur haben – sie schlafen oft unregelmäßig, leichter, mit weniger Tiefschlafphasen.
Und trotzdem glauben wir: Ich mache etwas falsch.
Diese Gedanken sind nicht nur unfair – sie verhindern genau das, was wir brauchen: Selbstmitgefühl.
Wenn du schlecht schläfst, weil dein Gehirn anders funktioniert, dann hast du keine „Schwäche“. Du hast eine Herausforderung. Und die darf gesehen und unterstützt werden. Es braucht keine Disziplinkeule – sondern Wissen. Verständnis. Und das Recht, sich selbst nicht mehr schuldig zu sprechen für etwas, das nie im eigenen Einfluss lag.
Schlaf ist kein Luxus – sondern ein Menschenrecht
Wir müssen aufhören, erholsamen Schlaf als Kür zu behandeln. Für viele neurodivergente Erwachsene ist Schlaf keine Selbstverständlichkeit, sondern täglicher Kampf. Ein Kampf gegen Reizoffenheit, Gedankenkreisen, ein überaktives Nervensystem und eine Gesellschaft, die Erschöpfung nicht ernst nimmt, solange sie nicht messbar ist.
Wer neurodivergent ist, schläft nicht schlecht, weil er zu viel am Handy hängt, zu wenig frische Luft bekommt oder sich nicht genug anstrengt. Es ist umgekehrt: Wir versuchen verzweifelt zu funktionieren in einer Welt, die unser Nervensystem überfordert – und wundern uns, wenn es nachts nicht abschaltet.
Mehr Wissen. Mehr Nachsicht. Mehr Handlung.
Was wir brauchen, ist kein weiterer Tipp für Abendroutinen. Wir brauchen:
- Hausärzt*innen, die Melatonin nicht nur Kindern zugestehen.
- Arbeitgeber*innen, die neurodivergente Müdigkeit ernst nehmen.
- Partnerinnen, Freundinnen und Familien, die nicht urteilen, wenn der Tag erst mittags beginnt.
- Und wir selbst: Wir brauchen unsere eigene Erlaubnis, Müdigkeit als echten Zustand zu akzeptieren – nicht als Schwäche.
Denn wer ständig gegen sich selbst antritt, schläft nie ganz sicher. Und vielleicht ist genau das die Aufgabe: Nicht nur nachts Frieden finden, sondern auch tagsüber aufhören, uns zu bekämpfen.
Du darfst schlafen. Du darfst Ruhe brauchen. Du darfst dich dem entziehen, was dein Nervensystem überfordert.
Denn Schlaf ist kein Luxus.
Schlaf ist Leben.
Wie geht es dir mit dem Schlaf?
Kennst du diese zähen Nächte, das Gedankenkreisen, die Überreizung nach zu wenig Ruhe?
Dann erzähl mir davon. Lass uns darüber sprechen, was sonst im Dunkeln bleibt.
Herzlich,
FliWi
#Schlaflosigkeit #Melatonin #ADHS #Autismus #Neurodivergenz #PDAProfil #Reizoffenheit #Selbstfürsorge #FliWiBlog #ErschöpfungIstReal #SchlafIstLeben #Charmeundchaos #AuDHS
Kommentar hinzufügen
Kommentare